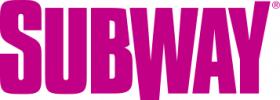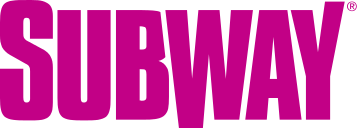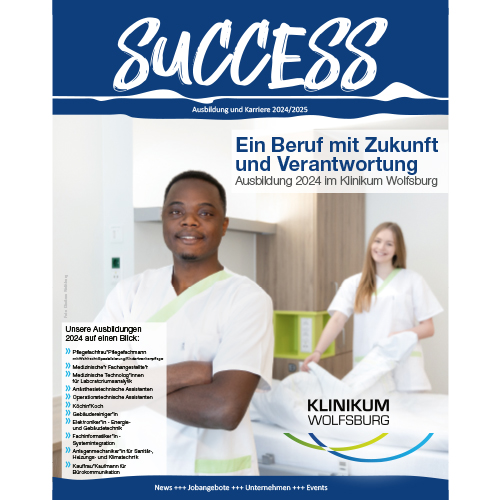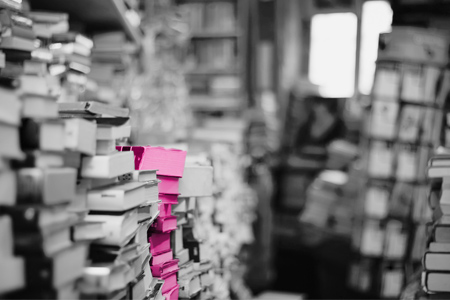Interview mit Alphaville zur ihrer Tournee 2025
Sie gelten als einflussreiche Wegbereiter des Synthie-Pop: Alphaville. Ihr „Big in Japan“ wurde 1984 weltweit zu einem Hit. Und dank TikTok ist ihr größter Erfolg “Forever Young” 40 Jahre nach Veröffentlichung wieder in den Charts. Mit dem aktuellen Triple-Album „Forever! Best Of 40 Years” geht die in Münster gegründete und in Berlin lebende Band auf große Jubiläumstournee. Frontmann Marian Gold, 70, gab Olaf Neumann Auskunft über seine wilden Jugendjahre, Konzerte in Krisengebieten und seine berühmten Fans Jay-Z und Beyoncé.
Sie sind in der deutschen Indie- und Undergroundszene groß geworden. Mit “Big In Japan” kamen Alphaville 1984 in England in die Top Ten und in den USA in die Billboard Hot 100. Waren Sie da schon Profimusiker?
Marian Gold Nein, wir waren überhaupt keine Profis. Ich stelle es mal anheim, ob ich heute einer bin. Wenn andere das über mich behaupten, ist das okay, aber die Attitüde von Professionalität möchte ich mir als Musiker selber nicht geben. Ich bin getrieben von obsessiver Liebe zur Musik und begebe mich immer wieder voller Neugierde auf für mich neues Territorium. Wir erfinden uns von Album zu Album neu. Und da gibt es immer Unsicherheiten, die einen dazu bringen, dass man aus professioneller Sicht Fehler macht, aus kreativer Sicht aber nicht.
Wie gehen Sie als Künstler mit Fehlern um?
Sie bringen uns meistens dazu, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Unsere Fähigkeiten und unser Instrumentarium waren anfangs sehr eingeschränkt. Als wir noch keine Rhythmusmaschine besaßen, haben wir Loops hergestellt. Das kannte ich von Brian Eno. Der hat Aufnahmen von Schallplatten auf Band geloopt und so zusammengeklebt, dass daraus ein Groove entstanden ist. Genau so haben wir bei unseren ersten Stücken gearbeitet. Und zu diesen Loops haben wir live gespielt, weil wir keinen Schlagzeuger wollten. Als wir dann aufgrund unseres monumentalen Erfolgs in Geld schwammen und uns alles leisten konnten, gab es es unheimlich viele Möglichkeiten. Aber das hätte uns nicht viel weitergeholfen.
Zu „Big in Japan“ wurden Sie inspiriert durch Berlins Drogenmilieu am Bahnhof Zoo. Geschrieben haben Sie den Text schon Mitte der 1970er. Kannten Sie Menschen aus diesem Umfeld persönlich?
Ja, ich war selber eine zeitlang obdachlos. Nach dem Abitur wurde ich zur Bundeswehr eingezogen, aber nach zehn Monaten haben sie mich wieder rausgeschmissen, unehrenhaft, wie man mir erklärte. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ich machen sollte und hatte auch keinen Kontakt zu meiner Familie. Ich bin dann von Plön nach Hannover gefahren und einfach in den nächsten Zug auf dem gegenüberliegenden Gleis gestiegen. Der fuhr nach Warschau, und in Westberlin musste ich aussteigen. Plötzlich fand ich mich mit einem Seesack am Bahnhof Zoo wieder.

Wie ging es für Sie weiter?
Die ersten Monate war ich mehr oder wenig obdachlos, das ging bis in den Winter hinein. Am Bahnhof Zoo lernte ich Punks kennen, die dort abhingen. Die wohnten in besetzten Häusern oder in Garagen. Die Dramen und Tragödien in diesem Umfeld haben einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen. Aus dieser Situation heraus ist der Text für „Big in Japan“ entstanden.
Aus welchem Grund wurden Sie unehrenhaft entlassen?
Ich war zu dieser Zeit sehr unmotiviert und an allem desinteressiert. Den Wehrdienst zu verweigern war mir zu anstrengend, dann hätte ich lügen müssen. Ich war ein ziemlich nutzloser Null-Bock-Typ, der dachte, er könnte die Bundeswehrzeit auf der linken Arschbacke absitzen. Aber dann stellte sich heraus, das Befehl und Gehorsam überhaupt nicht mein Ding waren und ich ganz schnell mit Vorgesetzten aneinandergeriet. Dieser Rausschmiss war meine Rettung.
Wie haben Sie es schließlich geschafft, in Berlin Fuß zu fassen?
Indem ich Bernd (Bernhard Lloyd) und Frank (Mertens) kennenlernte, die wie ich künstlerische Interessen hatten. Auf einmal versammelten sich solche Leute um mich herum. Wir waren alle politisch links gestrickt und gründeten in Münster die Nelson Community, in der jeder von uns neun seine kreativen Fähigkeiten erproben konnte. Irgendwann leisteten wir uns eine erste Rhythmusmaschine und einen Sequenzer. Auf letzterem haben wir den „Bachtrompetensatz“ für “Forever Young” programmiert. (lacht)
Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Obwohl auf einmal ganz viel Geld da war, ist das Nelson-Projekt zu meiner großen Freude noch bis Mitte der 1990er ohne die üblichen Streitereien weitergelaufen.
Das dritte Alphaville-Album – „The Breathtaking Blue“ – wurde von Elektronik-Pionier Klaus Schulze produziert. Was hat er Ihnen über Synthesizermusik beigebracht?
Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon unser eigenes Tonstudio in Westberlin am Mehringdamm. Klaus lernten wir über einen Bekannten kennen, der hochpreisige Mikrofone verkaufte und reparierte. Eigentlich wollten wir „The Breathtaking Blue“ alleine durchziehen, aber nach ein paar Nächten mit Klaus kamen wir auf die Idee, die Platte gemeinsam zu realiseren. Er meinte, das würde schnell vonstatten gehen. Das wollte er beweisen, indem er sich den Bart nicht mehr kürzte. Die Produktion dauerte dann ein Jahr, und sein Bart reichte ihm am Ende fast bis zum Bauchnabel. Durch Klaus kamen wir auf völlig neue Ideen. Manchmal sind aus einer Idee drei neue Stücke entstanden, und auf dem Album sind deswegen viele Stilistiken vertreten.
Wie lief die künstlerische Zusammenarbeit mit Klaus Schulze in der Regel ab?
Er hat immer die Musik konzipiert, sehr ausufernde Stücke. Wenn Klaus seinen musikalischen Anteil erledigt hatte, kam ich an die Reihe und er ging weg. Ich musste mir dann überlegen, was ich da singe und konnte dabei schalten und walten, wie ich wollte. Meistens gefiel ihm das Resultat, und er fing dann an, das Stück zu mischen. Das dauerte manchmal zwei Tage und Nächte. Klaus hat nonstop gearbeitet, er ging dann nicht ins Bett. Das jeweilige Stück lief permanent im Loop, und bei jedem Durchlauf veränderte er minimal etwas. Es war wie eine Meditation.
Sie sind siebenfacher Vater. Als frei schaffender Künstler weiß man oft nicht, woher man im nächsten Monat das Geld für die Miete kriegen soll. Woher bezogen Sie immer die Zuversicht, die man in diesem Job braucht?
Diese Zuversicht hatte ich schon immer. Ab dem Moment, in dem wir uns entschlossen hatten, Musiker zu werden, mussten wir uns um finanzielle Dinge keine Sorgen mehr machen. Seit 1984 ist alles super gelaufen.
1993 haben Alphaville kurz nach dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs in Beirut gespielt. Wie haben Sie das geschundene Land erlebt?
Diese zwei Konzerte waren einer der bewegendsten Momente in meiner Karriere. Als wir Musiker in Schönefeld ins Flugzeug stiegen, fragte uns ein Geschäftsmann, ob wir auch nach Beirut wollten. Er konnte es nicht glauben. Von oben, während des Anflugs, sah die Stadt aus wie Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wurden von schwerbewaffneten Soldaten im Eiltempo in den christlichen Teil der Stadt eskortiert, da waren die Zerstörungen weniger dramatisch.

Und wie waren die Konzerte?
Einfach überwältigend. Solch eine Hingabe habe ich nie wieder erlebt. Die Leute waren total beglückt, weil unser Konzert für sie ein Moment von friedvoller Normalität bedeutete.
Nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben Sie im Netz ein berührendes Statement gegen diesen sinnlosen Krieg veröffentlicht. Stehen Sie heute noch in Kontakt mit russischen Fans oder Konzertveranstaltern?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder in Russland werde auftreten können. Meine Befürchtung ist, dass der Kriegsverbrecher Putin davonkommt und irgendwann mit diesem Menschen verhandelt wird. Dann würde eine Akzeptanz für den kriminellen Angriff auf die Ukraine stattfinden. Natürlich sehe ich die Gefahr eines Nuklearkrieges, aber das hängt doch schon seit ewig wie ein Damoklesschwert über uns. Es gibt einfach Dinge, die sind nicht akzeptabel. Mein Aufruf im Netz richtete sich an unsere russischen Fans. Ich finde jeglichen Widerstand in Russland unterstützenswert, aber mir ist auch klar, dass jede Form von Kritik dort heldenhaft ist. Leider ist die Kommunikation mit russischen Fans seitdem mehr oder weniger verstummt.
Reden wir lieber über Positives: Jay-Z bat Sie um Erlaubnis, „Forever Young“ nutzen zu dürfen. Was war das für ein Gefühl, Ihren Song in der Version von ihm und Beyoncé zu hören?
Es ist für mich als Koautor ein überwältigendes Gefühl und großartiges Kompliment, wenn eine so wunderschöne Frau wie Beyoncé diesen Song mehr oder weniger eins zu eins interpretiert. Bei dem Telefongespräch mit Jay-Z ging es aber nicht um eine Erlaubnis, sondern ich brauchte einfach eine Kopie von dieser gesungenen und gerappten Version. Und das haben wir kurz diskutiert. Alles andere war da schon geklärt.
War diese Neufassung ein neuer Türöffner in die USA?
Nein, das war eigentlich nicht nötig. Unsere letzte Nordamerikatournee in 2017 war ein großer Erfolg. Alle Konzerte in Los Angeles, Houston, New York oder Chicago waren ausverkauft. Im Jahr darauf sind wir noch im Whisky-a-Go-Go in Hollywood aufgetreten. Das war die Erfüllung eines Kindheitstraums. Wir haben da zwei Nächte gespielt, da passen aber auch nur 400 Leute rein. Das ist in jedem Fall ein Verlustgeschäft, aber das war mir `ne Herzensangelegenheit, da mal aufzutreten. Als wir nach unserem letzten LA-Konzert über den Sunset zurückgefahren sind und ich die Neonbuchstaben vom Whiskey-a-Go-Go sah, konnte ich es kaum fassen, dass dieser legendäre Ort noch existiert. Und an meinem nächsten Geburtstag war es tatsächlich soweit.
Werden Sie auch mit dem neuen Album wieder um den Globus touren?
Wir sind seit Mitte der 1990er auf einer Never-ending-Tour. Wir sind eigentlich immer unterwegs, wenn wir nicht gerade im Studio sind. Nach der Tour zum Album werden wir wieder normale Rockshows spielen mit einem etwas anderen Programm. Die führen uns immer in alle möglichen Himmelsrichtungen. Ich hoffe, ich kann das noch eine Zeit lang machen, ich bin mittlerweile 70 Jahre alt. So langsam geht mir der Rock in die Knochen, aber Konzerte machen mir noch immer wahnsinnig viel Spaß. Ich bin halt ´ne Rampensau. Auf der Bühne geben wir alles. Es ist jedes Mal ein ekstatisch-orgiastischer Moment. Man wird süchtig danach.
Fotos Anna Wyszomierska