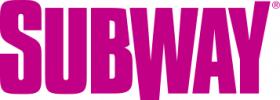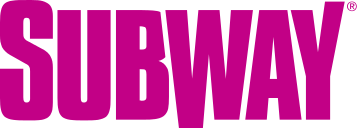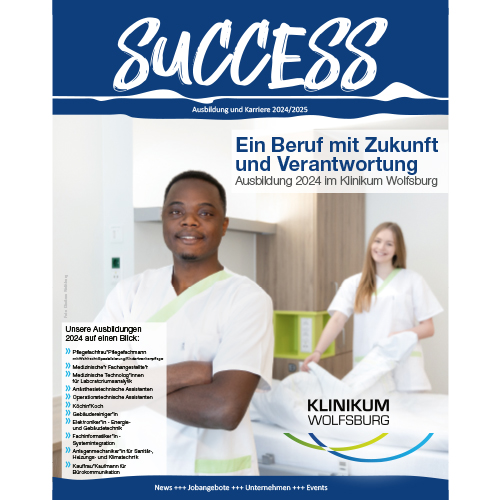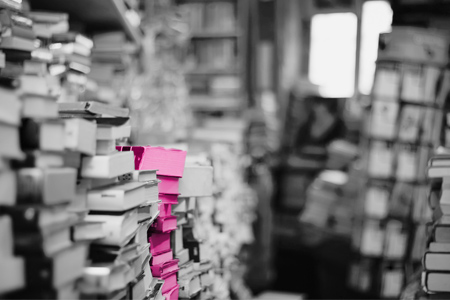Interview mit Julie Delpy zu „Die Barbaren – Willkommen in der Bretagne“
Sie kam als Tochter eines Schauspieler-Ehepaares in Paris zur Welt und trat bereits als Fünfjährige neben ihren Eltern auf. Mit 14 Jahren spielte Julie Delpy in Jean-Luc Godards Kinowerk „Detective“ mit. Später engagierten sie auch Regisseure wie Volker Schlöndorff („Homo Faber“) oder Jim Jarmusch („Broken Flowers“). Mit Richard Linklater drehte Delpy die Liebesfilm-Trilogie „Before Sunrise“, „Before Sunset“ und „Before Midnigt“. Regie führte sie bei bie „2 Tage Paris“ und der Fortsetzung „2 Tage New York“. Nun präsentiert die kreative Französin mit „Die Barbaren“ eine Komödie über Vorurteile und Migranten. Mit der Autorin, Hauptdarstellerin und Regisseurin unterhielt sich unser Mitarbeiter Dieter Oßwald.
Madame Delpy, in unserem Gespräch zu „Die Gräfin“ sagten Sie, Regie, Schauspiel und Drehbuch in einer Person seien zu anstrengend – und doch haben Sie es wieder getan. Warum?
Ja, es ist tatsächlich erschöpfend. Ich denke oft darüber nach, ganz aufzuhören. Aber manchmal finde ich Wege – etwa durch einen Produzenten, der mir hilft, den Film möglich zu machen. Die größte Herausforderung ist immer die Finanzierung vor dem Dreh. Wenn es dann klappt, ist es natürlich schön.
Und Ihren Vater wieder einmal für eine Rolle zu gewinnen, ist sicher auch nicht ganz einfach?
Nein, es ist zwar herausfordernd, aber mein Vater ist einfach großartig. Ich hoffe, mein nächster Film wird wieder mit ihm sein. Er ist inzwischen so etwas wie mein Maskottchen. Am Set bringt er alle zum Lachen – und treibt mich gleichzeitig in den Wahnsinn. Aber ich liebe ihn sehr und will so lange wie möglich mit ihm arbeiten.
 In populistischen Zeiten eine Komödie über Migration und Geflüchtete zu drehen, ist kein leichtes Unternehmen. Hatten Sie Angst davor?
In populistischen Zeiten eine Komödie über Migration und Geflüchtete zu drehen, ist kein leichtes Unternehmen. Hatten Sie Angst davor?
Ja, besonders in Frankreich gab es heftige Angriffe von der extremen Rechten. Dabei ist der Film im Kern eine Liebeserklärung an Menschlichkeit und Frieden. Er kritisiert den Hass, die Manipulation und die absurde Angstmache unserer Zeit. Diese Mechanismen begegnen uns täglich – etwa durch verfälschte Bilder oder falsche Zitate. Genau das wollte ich zeigen: wie leicht Angst geschürt wird. Populismus ist wie ein Krebsgeschwür. Deswegen war es mir wichtig, gerade jetzt so einen Film zu machen.
Sie haben von Anfeindungen in Frankreich berichtet. Wie sieht es in anderen Ländern aus?
In den USA ist es in Trump-Zeiten natürlich nicht leicht, solch einen Film in die Kinos zu bringen. Die Verleiher fürchten sich davor, die „Barbaren“ zu kaufen. Denn unser Film ist eine klare Ansage. Zu meiner großen Überraschung kommen wir in Ungarn in die Kinos, und dort läuft er sogar ziemlich gut. Bei meinem Besuch in Budapest haben mir viele Leute gesagt, sie hätten die Nase einfach nur noch voll von diesem autoritären Regierungschef. Es gibt also auch Hoffnung. Und für mich ist es ein gutes Zeichen, dass die „Barbaren“ nun auch in die deutschen Kinos kommen.
Ihr Film wirkt trotz der Thematik leichtfüßig. Wie wichtig ist Ihnen die politische Botschaft?
Ich nehme mich selbst nicht so wichtig – ich bin ja „nur“ Filmemacherin. Aber es ist ein Film mit Herz und Haltung, das war mir wichtig. Ich wollte Humor und Hoffnung vermitteln. Die Dreharbeiten waren geprägt von Freude, und ich glaube, das spürt man. Es ist ein einfacher Film, aber mit einer klaren Botschaft.
 Das kleine bretonische Dorf erinnert ein wenig an das aus „Asterix und Obelix“. War das beabsichtigt?
Das kleine bretonische Dorf erinnert ein wenig an das aus „Asterix und Obelix“. War das beabsichtigt?
Ja, ich bin mit Asterix aufgewachsen – und der Film spielt sogar in der Bretagne. Ich wollte genau dieses Gefühl: ein kleines, schrulliges Dorf, in dem jeder jeden kennt. Eine einzige Straße voller Typen, wie aus einem Comic. Das hat etwas Zeitloses.
Sie spielen gezielt mit Klischees – viele scheuen das. Wie hält man die Balance?
Für Komödien braucht man ein gewisses Maß an Klischee – sonst funktioniert der Humor nicht. Aber bei der Flüchtlingsfamilie war mir wichtig, sie vielschichtig zu zeigen. Wir haben intensiv recherchiert und Interviews geführt, um die Figuren realistisch zu gestalten. Denn sie tragen unsere alltäglichen Sorgen – und dazu noch Trauma, Verlust und das Gefühl, nicht willkommen zu sein.
Dabei ist der Film im Kern eine Liebeserklärung an Menschlichkeit und Frieden. Er kritisiert den Hass, die Manipulation und die absurde Angstmache unserer Zeit.
Am Ende verlieben sich die Kinder der Migranten und der Einheimischen ganz selbstverständlich ineinander. Ist das Ihre kleine Utopie?
Ja, das war mir sehr wichtig. Der Junge ignoriert alle rassistischen Sprüche seiner Freunde. Liebe überwindet Vorurteile – das ist meine Idealvorstellung. Ich wollte ein modernes Märchen erzählen, in dem Liebe am Ende siegt. Ich glaube fest daran, dass Hass irgendwann untergeht – auch wenn es dauert.


Was halten Sie vom Prädikat: „Ein Ken Loach – aber mit mehr Leichtigkeit“?
Ich liebe Ken Loach, er ist einer meiner Lieblingsregisseure. Aber mein Ansatz war ein anderer – ich wollte keine Tragödie erzählen. Es gibt genug Dunkelheit da draußen. Ich wollte mit Humor und Wärme eine Botschaft der Hoffnung senden. Ein kleines Licht in einer düsteren Zeit.
Zum Schluss bleibt die Frage: Wo ist dieses Mal Daniel Brühl? Sie haben vier Filme mit ihm gemacht – und nun fehlt er!
Ich liebe Daniel – er hat sogar meinen letzten Film mitproduziert. Aber diesmal gab es einfach keine Rolle für ihn. Vielleicht beim übernächsten Projekt. Ich arbeite sehr gern mit ihm, und das wird sich auch nicht ändern.
Fotos THE FILM